Energon - der Background
Physiologie, Mathematik, Musik und Medizin: Definitionen und Konzepte für die Forschung
von Ralph Spintge
Einführung und Begriffserklärung
In den vergangenen 15 Jahren sind bedeutende Fortschritte sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Anwendung von Musik in der Medizin erzielt worden. Heute schließlich liegen zuverlässige Beweise dafür vor, daß Musik eine reproduzierbare Wirkung ausübt und über wertvolle therapeutische Eigenschaften verfügt. Aus diesem Grund schlagen wir als Begriff für den therapeutischen Einsatz von Musik in der Medizin die Bezeichnung MusikMedizin (ein Wort, zwei große M) vor.
Ebenso umfassend wie wesensbezogen steht das Wort "MusikMedizin" für eine wissenschaftliche Bewertung musikalischer Stimuli im medizinischen Bezugsrahmen, insbesondere über mathematische, physikalische, physiologische und medizinische Untersuchungen - aber auch im Hinblick auf ihre therapeutische Anwendung zur Ergänzung traditioneller Heilmethoden unter Beachtung des jeweiligen Krankheitsfalles, der zugehörigen Medikation sowie des individuellen Procedere (s. auch Spintge & Droh 1992a; Maranto 1992; Pratt 1995).
Dieser Ansatz unterscheidet sich von dem der Musiktherapie als Teil der psychiatrischen Fürsorge oder der Psychotherapie (Aldridge 1993). Wir verstehen Musiktherapie als psychotherapeutische Anwendung der Musik, als eigenständige Spezialität. Natürlich besteht grundsätzlich ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen MusikMedizin und Musiktherapie. Hinzu kommt, daß der Begriff "Musikmedizin" heute auch mit Berufskrankheiten von Musikern und Tänzern assoziiert wird.
Die Hauptfrage in diesem Zusammenhang bleibt jedoch noch immer unbeantwortet: Warum ist Musik wirksam und welche sind ihre Wirkungsparameter? Es scheint allgemeiner Konsens darüber zu bestehen, daß Musik möglicherweise das wirksamste emotionale und ästhetische Kommunikationsmittel überhaupt ist. Es gab und gibt keine menschliche Zivilisation, in der nicht Musik gemacht und erlebt wurde. Die Frage bleibt: wie können wir den musikalischen Code für emotionale Kommunikation entschlüsseln? Unsere klinische Arbeit führt uns zu der Annahme, daß der Rhythmus das effektivste musikalische Element darstellen könnte. Der musikalische Rhythmus wird als strukturierte Abfolge von metrischen, melodischen und harmonischen Einheiten über die Zeit innerhalb eines Musikstückes verstanden. Von einem eher biologisch orientierten Blickwinkel aus betrachtet, ist er eine strukturierte Abfolge von zeitbezogenen Funktionseinheiten innerhalb eines dynamischen Systems.
Die wesentliche Rolle des Rhythmus wird beispielsweise durch unsere Erkenntnisse über die Wurzeln der Musik und der Heilkunde bestätigt. Die menschliche Kulturgeschichte war schon immer auch eine Geschichte der Religion, der Heilkünste und genauso die Geschichte der Musik. Musik war schon in der Steinzeit, vor rund 12.000 Jahren, Bestandteil des menschlichen Lebens (Soffer 1985). Bereits aus den ältesten erhaltenen schriftlichen Belegen für die Existenz der Heilkünste geht die Anwendung von Musik als Teil eines mystischen, religiösen Heilungszeremoniells hervor (Codex Hammurabi, ca. 4.000 v. Chr., s. auch Übersicht bei Spintge 1992a).
Später wurde die Musik selbst zum Heilmittel (Kuemmel 1977). Wenn wir uns mit dem spezifischen Wert beschäftigen, den die Musik offenbar für den Menschen der Frühzeit besaß, sollten wir uns des Umstandes bewußt werden, daß die Wahrnehmung der Zeit als Grundbestandteil unserer Existenz in rhythmischen Zyklen organisiert ist, wie etwa Tag und Nacht, die Aufeinanderfolge der vier Jahreszeiten, der Menstruationszyklus etc. Seit Anbeginn der menschlichen Existenz hatte die Organisation der Zeit selbstverständlich immer einen ganz besonderen, überlebenswichtigen Stellenwert. Heutzutage stellt die Lehre von den Biorhythmen einen neuen, aber bereits fest etablierten Wissenschaftszweig dar. Diese beherrschen das Verhalten biologischer Systeme von der molekularen Ebene bis hin zu makroskopischen Verhaltensmustern ganzer Gruppen von Individuen.
Ist Rhythmizität das fehlende Bindeglied zwischen Musik, Physiologie und Medizin?
Dieses Thema ist Gegenstand unserer derzeitigen Untersuchungen. Rhythmizität wird als strukturierte Koordination zweier unterschiedlicher Rhythmen über die Zeit in einem dynamischen System verstanden, einschließlich interaktiver Phänomene wie Synchronisation, Extinktion, Verstärkung und Kopplung (Abel, Geier, Spintge u. Droh 1996; Lex, Pratt, Abel u. Spintge 1996). Das Basiskonzept, auf dessen Grundlage wir unsere physiologischen Studien durchführen, ist die folgende Definition der MusikPhysiologie:
Die MusikPhysiologie als Naturwissenschaft untersucht die biologischen Eigenschaften der ars musica, die wiederum menschliche Emotionen und Gefühle durch eine harmonische und rhythmisch strukturierte Abfolge von akustischen Stimuli zum Ausdruck bringt. Alle musikalischen Parameter zeigen einen gewissen Grad einer Zeitordnung oder Zeitstruktur im Ablauf des musikalischen Prozesses. Daher sucht die MusikPhysiologie nach biologischen Zeitstrukturen beim Menschen, die eine äquivalente "Resonanzadress" für musikalische Zeitstrukturen darstellen könnten.
Abbildung 1 veranschaulicht mein sogenanntes "missing-link-Konzept" der zwischen Physiologie, Medizin, Mathematik / Physik und Musik bestehenden wechselseitigen Beziehungen, mit der Rhythmizität als zugrundeliegendes verbindendes Prinzip. Präzise ausgedrückt, gilt diese Betrachtung derzeit nur für anxioalgolytische (angst- und schmerzlindernde) Musik (AAM).
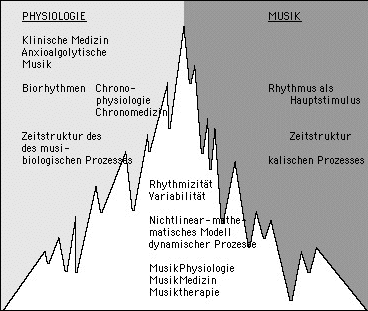
ABB. 1:
Das "missing-link-Konzept": Grundlage der MusikPhysiologie, MusikMedizin und Musiktherapie - die Wechselbeziehungen zwischen Physiologie, Medizin, Mathematik und Musik mit der Rhythmizität als mögliches Bindeglied ("missing link").
Musik, Physiologie und Mathematik
Rhythmen stellen eins der beherrschenden Grundphänomene - vielleicht sogar das vorherrschende Phänomen - in allen biologischen Systemen dar (Haken & Koepchen 1991). Erst kürzlich haben Untersuchungen zur Rhythmizität in Physiologie, Medizin und Mathematik ein breites Interesse geweckt. Während musikalische Rhythmen per se interessant für Musikologen, Musiker, Musikpsychologen und Musiktherapeuten sind, hat sich die Rhythmusforschung rasend schnell in physikalischen, physiologischen und mathematischen Untersuchungsansätzen sowie in der klinischen Medizin ausgebreitet.Dieser Trend wird durch neue Methoden der Datenerhebung und -analyse noch gefördert.
Nicht-invasive Methoden zur kontinuierlichen Betrachtung von dynamischen physiologischen Prozessen in Verbindung mit computergestützten Bewertungssystemen wie auch neuartige mathematische Konzepte zur Analyse von nicht-linearen biologischen Systemen erlauben es, die komplexen Wechselwirkungen von unterschiedlichen oszillierenden Systemen zu beobachten, zu beschreiben, zu visualisieren und auch vorherzusagen (Haken 1978, 1986; Haken & Koepchen 1991).
Ein solches System könnte beispielsweise die Musik sein, das andere die Rhythmizität der Herzfrequenz oder die elektrische Hirnaktivität (EEG). Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, daß Gesetzmäßigkeiten biophysikalischen Verhaltens wie auch die Methoden zur Beschreibung ihrer Wechselwirkungen in so gänzlich verschiedenen Bereichen wie Physiologie, Laserphysik, Ökologie, Wirtschaftslehre, Straßenverkehrsüberwachung, Wachstumsmuster von Pflanzen, Kardiologie und anderen mathematisch berechenbar sind (Haken & Koepchen 1991; Haken 1992).
In der Medizin belegt die Rhythmusforschung bereits eine große Bandbreite von Phänomenen wie etwa Herzfrequenz-Variabilität (Ereignisvorhersage nach Herzinfarkt), Autorhythmizität von Blutgefäßen (Steuerung von Blutdruck und Durchblutung), rhythmische Aktivität des sympathischen Nervensystems (Performance-Steigerung bei Leistungssportlern, Linderung chronischer Schmerzen), Rhythmogenese von Atmungsvorgängen (Schlaf-Apnoe, plötzlicher Kindstod), Synchronisation und Koordination motorischer Funktionen (Leistungssteigerung im Sport), zirkadiane Schlafrhythmen, elektrische Hirnaktivität, Oszillation in der Wahrnehmung, chemische Kommunikationsvorgänge im Zellinneren und zwischen den Zellen, und viele andere mehr (Abel, Berger, Conze, Droh, Klüssendorf, Koepchen, Koralewski, Krause, Spintge 1994; Haken, Kelso u. Bunz 1985; Haken & Koepchen 1991).
Auch wenn einige Forschungsgruppen versucht haben, ein umfassendes mathematisches Modell für die Musik zu erstellen, sind wir eher der Ansicht, daß es lohnender ist, mit nur einem musikalischen Parameter zu beginnen - dem Rhythmus. Ein kurzer Abriß unseres musikphysiologischen Konzeptes folgt weiter unten (weitere Einzelheiten siehe bei Koepchen, Droh, Spintge, Abel, Klüssendorf u. Koralewski 1993). Biologisches Leben ist ein rhythmisch organisierter Prozeß mit Frequenzen, die sich über eine große Bandbreite erstrecken. Sogar Moleküle, die kleinsten Komponenten der Lebensfunktion, durchlaufen oszillatorische chemische und funktionale Wandlungen.
Das menschliche Leben ist als Teil der lebendigen Welt eingebettet in rhythmische Ordnungen, auch wenn wir nur einen sehr begrenzten Teil all dieser Rhythmen bewußt wahrnehmen. Die meisten makroskopisch beobachtbaren Rhythmen basieren auf der wechselseitigen Koordination vieler Einzelelemente in einer ganz charakteristischen Form der Selbstorganisation. Auf diese so sehr unterschiedlichen Lebenssysteme kann eine nichtlineare mathematische Analyse der Selbstorganisation angewandt werden. Da die sich wechselseitig beeinflussenden physiologischen Rhythmen durch die Synchronisation und Selbstorganisation aus lauter oszillierenden Untereinheiten entstehen, ist diese neue Art der Mathematik imstande, die komplexe biologische Rhythmizität zu quantifizieren und zu analysieren.
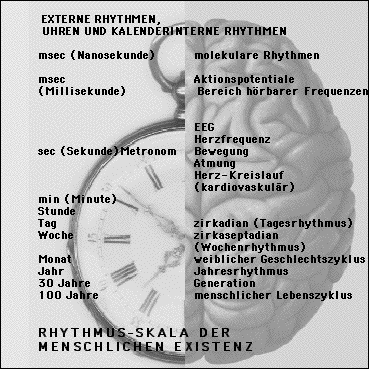
Abb. 2:
Bandbreite der Frequenzen menschlicher physiologischer Rhythmen auf einer logarithmischen Skala mit den Frequenzen auf der linken und den Perioden auf der rechten Seite. Externe Rhythmen, die von der Außenwelt her auf den Organismus einwirken, werden auf der linken Seite angezeigt, interne Rhythmen auf der rechten. Die Dreiecke auf der rechten Seite charakterisieren den Bereich, in dem die jeweiligen Rhythmen auftreten, und die typische Frequenz für den betreffenden Rhythmus. Man beachte die großen Frequenzbreiten mit beträchtlichen Überlappungen im Bereich der neurovegetativen und motorischen Rhythmen, verglichen mit den kleinen Variabilitäts-Bandbreiten der langsameren Rhythmen, die durch Anpassung an externe Rhythmen entstanden sind.
Bemerkenswert ist auch, daß der Frequenzbereich, der in einem Metronom (das in musikalischen Studien benutzt wird) angelegt ist, exakt mit dem Frequenzbereich des Herzschlages übereinstimmt, die zwischen Ruheperioden und körperlicher Arbeit auftreten können. Im Hinblick auf die physiologische Rhythmizität weist dieser Bereich einige charakteristische Merkmale auf: diese Rhythmen erscheinen in Systemen mit homöostatischer Rückkopplungs-Eigenregulierung vitaler Funktionen wie etwa der Steuerung des arteriellen Blutdruckes oder der Blutgaskonzentration. Daraus resultiert, daß zwischen der homöostatischen Funktion der Stabilität und dem rhythmischen Wechsel (der Veränderlichkeit) von vitalen Parametern ein permanenter Wettbewerb stattfindet, wobei beide Parameter den jeweils anderen begrenzen.
Dies trifft insbesondere für die Wechselwirkungen zwischen den vegetativen (autonomen) und den somatomotorischen Systemen zu. Man darf dabei nicht außer acht lassen, daß die rhythmische Steuerung vegetativer Prozesse in einem gemeinsamen Netzwerk von Neuronen im Gehirn stattfindet, die gleichzeitig für den Wachzustand des Gehirns wie auch für die Kontrolle des Muskeltonus‘ zuständig sind. Aus diesem Grunde ist dieses neuronale Netzwerk bei der zentralen Steuerung des emotionalen Verhaltens, so auch bei der Streßreaktion involviert. Eine der zuvor angesprochenen Wechselwirkungen, "Einkoppelungseffekt" bzw. neudeutsch "entrainment" genannt, besteht darin, daß ein Rhythmus mit einem anderen synchronisiert. Die qualitative Erfassung der Eigenschaften der Einkoppelung ist einfach - beispielsweise in der Synchronisation von motorischer Bewegung und Atmung bei Ruderern oder Schnelläufern. Eine quantitative Analyse dieser Wechselbeziehungen dagegen ist sehr viel schwieriger.
Erich von Holst hat im Jahre 1939 als erster die beiden Prinzipien nachgewiesen, die die nachfolgenden komplexen physiologisch-rhythmischen Phänomene steuern: a) den "Magneteffekt" und b) die "Überlagerung". Der Magneteffekt ist die Grundlage der Einkoppelung und kann in Form von statistisch bevorzugten Phasenbeziehungen erklärt werden, die auch dann auftreten, wenn keine Synchronizität erreicht wird. Für gewöhnlich führt ein Rhythmus, und der andere ist von ihm abhängig. Überlagerung hingegen bedeutet ganz einfach, daß die Amplitude des einen Rhythmus‘ zu der des anderen hinzugezählt oder von ihr abgezogen wird, ohne daß dadurch die Phase beeinflußt wird. Zumeist liegt eine Mischung von Magneteffekt und Überlagerung vor. Von Holst prägte den Begriff "relative Koordination", um diese Regeln in ihrer Gesamtheit zu beschreiben. Sie sind nicht nur auf die Wechselwirkung unterschiedlicher interner Rhythmen anwendbar, sondern auch auf die Einwirkung der Umwelt auf interne Rhythmen. Dies kann man bei der Koordination von Beinbewegungen bei Rennpferden beobachten wie auch bei der Saug- und Atemaktivität von Säuglingen oder menschlichen Handbewegungen (Haken, Kelso u. Bunz 1985).
Die Rhythmen und oszillatorischen Muster, die das Leben allgemein auszeichnen, sorgen für die Flexibilität und kreative Variabilität, die zur Aufrechterhaltung des Lebens den herausfordernden und lebensbedrohenden Umweltbedingungen gegenüber vonnöten sind. Vom medizinischen Standpunkt aus betrachtet, ist es unbedingt erforderlich, nicht nur darüber Bescheid zu wissen, wie diese individuellen Rhythmen physiologischer Funktionen entstehen, sondern auch, wie von außen einwirkende rhythmische Stimuli - etwa die Musik - die Modulation der inneren Rhythmen beeinflussen. Aus diesem Wissen ergibt sich ein gewisser Grad an Vorhersagbarkeit normaler und abnormaler physiologischer Verhaltensmuster
a) unter den verschiedensten Streßbedingungen,
b) bei chronischen Krankheiten und chronischem Schmerz, und
c) unter physischer Belastung, mit und ohne Musik, usw.
Allgemeine Beziehungen zwischen physiologischen Funktionen und Musik
Wir möchten den Gedanken vortragen, daß der Mensch die wesentlichen rhythmischen Komponenten der Funktionen des ZNS (wie auch des übrigen Organismus) in eine Schöpfung hineinprojiziert hat, die als Musik (und Tanz) bezeichnet wird. Je genauer wir uns die spezifische Selbstorganisation physiologischer Funktionen anschauen - bis hinunter zur molekularen Ebene -, desto mehr Belege finden wir für diese unsere Annahme. Wir glauben, daß abstrakte mentale Aktivitäten mit musikalischen Strukturen korrespondieren, und daß rhythmische motorische Aktivität sowie die neurovegetativen Rhythmen des ZNS genauso mit dem musikalischen Rhythmus korrespondieren wie der emotionale Status eines Menschen mit dem Gefühlsgehalt der Musik.
Indem wir mit dem zuletzt angeführten Segment dieses Konzeptes den Anfang machten, wandten wir die Methodologie der psychophysiologischen Emotionsforschung auf die emotionalen Auswirkungen von Musik in einer spezifischen Situation an, in diesem Fall die der Angst. Unsere diesbezüglichen klinischen Ergebnisse sind bereits veröffentlicht worden und haben unsere Hypothese zum emotionalen Teil des Konzeptes bestätigt (Spintge & Droh 1987, 1992a; Spintge 1994).
In der Physiologie haben Forschungen das Phänomen der Rhythmizität entschleiert, die anscheinend das Bindeglied, den Hauptmechanismus hinter dem Einfluß von Musik auf die menschliche Biologie darstellt. Der springende Punkt dabei ist, daß eine enorme Vielfalt und Bandbreite rhythmischer Phänomene im Organismus auf einige wenige Grundprinzipien zurückgeführt werden kann, die so diesen Bereich für wissenschaftliche Analysen und eine quantitative Beschreibung zugänglich machen. Unsere gegenwärtige Forschungstätigkeit richtet ein Hauptaugenmerk auf die Kontrolle neurovegetativer Mechanismen über die interne physiologische Rhythmizität. Neurovegetative Rhythmizität ist ein vom ZNS beherrschtes Instrument, das auf innere Organe und Organsysteme wirkt.
In der englischsprachigen Fachliteratur wird für "neurovegetativ" eher der Ausdruck "autonom" benutzt, im Sinne von "unabhängig von willensgerichteten Einflüssen". Wie bereits zuvor erwähnt, können wir in den gängigen Musikrhythmen den Rhythmus des Herzschlages identifizieren, ebenso den Herzschlagrhythmus sowie den Atemrhythmus in der neurovegetativen Physiologie. Der Rhythmus des Herzschlags hat seinen Ursprung im Reizbildungszentrum des Herzens, dem Schrittmacher, und wird durch Einflüsse des zentralen Nervensystems (neurovegetative Efferenzen) modifiziert. Der Atemrhythmus hingegen wird im ZNS selbst erzeugt.
Externe Rhythmen - musikalische eingeschlossen - wirken also nicht auf einen passiven oder statischen Organismus, sondern auf ein dynamisches, komplexes und primär rhythmisches System. Sämtliche Aufzeichnungen über Blutdruck, Herzfrequenz, periphere Durchblutung sowie erst kürzlich entstandene Direktaufnahmen sympathischer Nervenaktivität beim Menschen belegen, daß bei gesunden Personen die gleichen Muster rhythmischer Variabilität, sprich: Rhythmizität, vorliegen.
Es ist ein allgemeingültiges Prinzip, daß ein pathologischer Zustand sich durch einen Verlust von Rhythmizität auszeichnet. Im Hinblick auf die Frequenzen rhythmischer Variabilität gibt es im Bereich der kardio-vaskulären Rhythmizität zwei bevorzugte Frequenzen. Die eine bewegt sich im Bereich von 0,1 Hz (MFB = Mittelfrequenzband) und ent-spricht einer Periode von 10 Sekunden. Die andere liegt bei 0,25 Hz (HFB = Hochfrequenzband). Im HFB-Bereich liegt auch die gewöhnliche Atemfrequenz im Ruhezustand. Relative Koordination, wie oben erwähnt, kann am Beispiel der bekannten respiratorischen Herzarrythmie (Sinus-Arrythmie) aufgezeigt werden.
Sie ist leicht festzustellen, indem man bei ruhiger Atmung den Puls fühlt. Beim Einatmen erhöht sich die Herzfrequenz, beim Ausatmen verlangsamt sie sich. Eine vorbereitende quantitative mathematische Beschreibung der Rhythmizität kann durch die Fourier-Transformation dargestellt werden. So können rhythmische Veränderungen in Form sogenannter Power-Spektren wiedergegeben werden. Die Spitzen (peaks) zeigen dabei den Frequenzinhalt des rhythmischen Prozesses an.
Da biologische Prozesse nichtlinear dynamisch verlaufen, prüfen wir gegenwärtig noch weitere für Analyse und Beschreibung geeignete mathematische Hilfsmittel, wie etwa Phasendiagramme, Fraktale und Torus-Attraktoren zur multidimensionalen Visualisierung des jeweiligen Prozesses. In Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut in Dortmund, dem Bundesforschungszentrum in Jülich sowie dem Stuttgarter Institut für Theoretische Physik und Synergetik versuchen wir, Algorithmen anzuwenden, die aus der Chaostheorie und der Synergetik stammen (Schiek 1994).
Theoretischer Ausgangspunkt der mathematischen (synergetischen) Betrachtung ist die Annahme, daß die Musik als sogenannter Ordnungsparameter (order parameter) (Haken 1986) die rhythmische Steuerung der physiologischen Systeme im Organismus ihrer Herrschaft unterwirft. Die synergetische Mathematik zeigt uns, daß dynamische Lebensprozesse den gleichen Prinzipien gehorchen wie physikalische Phänomene. Das bedeutet, daß alle diese Vorgänge mathematisch beschrieben und ihre evolutionären Alternativen im voraus berechnet und - in spezifischen Situationen - sogar vorhergesagt werden können (Haken 1978,1983; Hofstadter 1979).
Bereits kleine Veränderungen zu Beginn können ein ganzes System umbauen. Daher kann auch die Art der spezifischen Eingangsmodifikationen die ganze Richtung ändern, in die sich der dynamische Prozeß entwickelt. Diese Konzept ist bereits erfolgreich in die medizinische Behandlung von Infarkpatienten übertragen worden. Deren spezifische Anfangsveränderungen im rhythmischen Muster des EKG scheinen einen gewissen Aussagewert für die Vorhersage des Behandlungserfolges aufzuweisen. Warum sollen wir dann nicht Musik als externen Stimulus zur Induzierung von Eingangsveränderungen einsetzen, die das System (den Organismus) zu einer angestrebten Verhaltensweise veranlassen? Auch wenn diese Konzeption faszinierend anmuten mag - sie steckt noch in der Entwicklungsphase (vgl. auch Abb. 1).
Mandelbrot führte das Konzept der fraktalen Geometrie zur Beschreibung von Formen und Gestalt in der Natur ein (1977, 1991). Diese Formen können als amorph, d. h. als zufallsabhängig, bruchstückhaft, unregelmäßig und selbstähnlich beschrieben werden, insbesondere dann, wenn man sich vom makroskopischen Beobachtungsniveau auf die mikroskopische Ebene begibt. Dieses Prinzip wird auch bei dem Versuch deutlich, eine Karte mit der Küstenlinie der Vereinigten Staaten zu zeichnen, oder beim Zeichnen eines Schneekristalls oder des Wurzelwerkes einer Pflanze. In jedem dieser Fälle wird die Struktur durch Parameter (selbst-)organisiert, die mathematisch beschrieben und als "seltsame Attraktoren" (strange attractors) und Ordnungsparameter bezeichnet werden können (weitere Einzelheiten hierzu bei Haken & Wunderlin 1991; Mandelbrot 1977; Prigogine & Stengers 1986).
Diese modernen mathematischen Konzepte lassen uns erkennen, daß Struktur, Sebstorganisation und Verhalten in der nichtbelebten wie in der lebendigen Natur von den gleichen Prinzipien gesteuert werden (Gerok 1989). Was wie Chaos aussieht, ist gar kein Chaos. Vor ziemlich genau 500 Jahren (1594) hatte Johannes Kepler das bereits begriffen, als er zu der Erkenntnis kam, daß die Harmonie des Universums durch seine harmonischen Wechselwirkungen besteht. Die Astrophysik lehrt uns, daß diese universelle Harmonie in der Tat durch Chaos in einem gewissen Rückkoppelungsprozeß erzeugt wird (Cramer 1989, S. 182). Sogar dynamische biologische Systeme, die zunächst offen und auf den ersten Blick von Nichtvorhersehbarkeit und Instabilität beherrscht erscheinen, können mathematisch beschrieben werden. Darüber hinaus kann auch ihr Funktionsverhalten insoweit vorhergesagt werden, als daß "wir wissen, daß der Schlag eines Schmetterlingsflügels in Hongkong einen Wirbelsturm in New York erzeugen kann" (Briggs & Peat 1989, S. 178).
Die sich hieraus für unser Weltbild, die menschliche Philosophie und Religion ergebenden möglichen Konsequenzen sprengen bei weitem den Rahmen der vorliegenden Abhandlung; es gibt Vordenker in den Naturwissenschaften, der Kunst und den Geisteswissenschaften, die dazu wesentlich mehr zu sagen hätten als der Autor dieses Beitrages. In jedem Fall drängt sich die Frage auf, ob diese Konzepte sich in bezug auf die menschliche Natur als Ganzes bewähren, und ob sie für die Funktionen des menschliche Gehirns im Allgemeinen Geltung besitzen. Und wie steht es diesbezüglich mit der Musik?
Es gibt mittlerweile fraktale Musik und eine aufblühende moderne Schule für fraktale Komposition (Dodge & Bahn 1986; Bohm & Peat 1987). In der klassischen Musikliteratur wird vom Prinzip der Selbst-Ähnlichkeit ausgiebig Gebrauch gemacht - ohne irgendwelche genaueren Kenntnisse der fraktalen Geometrie, versteht sich. Dabei muß ein Genie wie Bach einfach ein intuitives Gefühl für die Organisation dynamischer Prozesse und ihre Umsetzung in Musik und umgekehrt gehabt haben.
Können diese Konzepte und Theorien unterschiedlichster Disziplinen unter einen Hut gebracht werden? Ja, ich glaube schon. Und ich bin sicher, daß die MusikMedizin ein geeignetes Vehikel für diese Synthese darstellt. Unsere Vorfahren erklärten, es sei die Aufgabe eines Künstlers, der Natur einen Spiegel vorzuhalten. Einen Spiegel aus Alice‘s Wunderland, voller spielerischer Ungewißheit, wie in der Natur selbst; ein Spiegel, der dem uralten Spannungsverhältnis zwischen Ordnung und Chaos, Gewißheit und Ungewißheit, Materie und Geist, Naturwissenschaft und Kunst neues Leben einhaucht.
Zurück zur Musik in der Medizin
Die Anwendung der zuvor beschriebenen physiologischen, physikalischen und mathematischen Modelle und Konzepte auf den Menschen zeigt, daß das kardiovaskuläre System in einem entspannten und schmerzfreien emotionalen Zustand seine eigene bevorzugte Rhythmizität im oberen Frequenzbereich aufweist, während die Rhythmizität der Atmung im mittleren Frequenzbereich liegt. In dieser Situation liegt sowohl eine Synchronisation als auch eine Überlagerung der beiden Rhythmen vor, und als Ergebnis können ausgedehnte, langsame Herzfrequenzveränderungen beobachtet werden. Das Gegenteil ist der Fall bei emotionalen Bedrängniszuständen (besser gesagt: bei emotionalem Distress). Bei Angst oder Schmerzen beispielsweise, sowie in pathologischen Zuständen wie Diabetes, Nierenversagen oder Herzkrankheiten ergibt sich eine Abnahme der Herzfrequenz-Variabilität.
Wir nehmen daher an, daß ein Verlust der Rhythmizität ein charakteristisches Merkmal hoher physischer oder geistiger Belastung ist, wie etwa bei Angst oder Schmerzen. Auch wenn wir bereits damit begonnen haben, Power-Spektren und Phasendiagramme von Schmerzpatienten auszuwerten, so ist es noch zu früh, um abschließend von reproduzierbaren Abweichungen im Vergleich zu normalen Personen zu sprechen. Unsere derzeitige, vorläufige Einschätzung läuft darauf hinaus, daß an chronischen Schmerzen leidende Patienten eine auffällige Abnahme der Herzfrequenz-Variabilität mit einer einzigen, aber kleinen Spitze im Hochfrequenzbereich aufweisen. Es wird jedoch noch beträchtliche Forschungsarbeit geleistet werden müssen, bevor man zu einer endgültigen Festlegung im Hinblick auf ein nichtinvasives Instrument zur Schmerzquantifizierung von derartiger Tragweite kommen kann.
Was wir im Hinblick auf Entspannungstherapie im Allgemeinen feststellen können, ist, daß man, wollte man mit Hilfe eines Metronoms einen regelmäßigen Herzrhythmus herbeiführen, aus physiologischer Sicht beträchtlichen Schaden bei den betroffenen Patienten anrichten könnte. Sogenannte Entspannungsmusik mit einem unterlegten fixen "Herzschlag-Ruhe-Rhythmus" von konstant 60 Schlägen pro Minute ist völlig unphysiologisch und könnte allenfalls im Sinne der obigen Ausführungen die gesunde Flexibilität des Herz-Kreislauf-Systems hin zu krankhafter Starre bewegen.
Nichtsdestotrotz: genau an dieser Stelle tritt die Musik als komplexer und dynamischer Stimulus von ebenso ästhetischer wie emotionaler Bedeutung auf den Plan. So paßt beispielsweise die Variabilität rhythmischer Stimulation durch anxioalgolytische Musik (AAM, angst- und schmerzlindernde Musik), insbesondere mit klassischer Musik, sehr gut zur Frequenzbreite gesunder physiologischer, neurovegetativer Steuerung im Ruhezustand. Einige Studien hierzu sind gegenwärtig bereits abgeschlosssen oder noch in Arbeit. Eine von ihnen umfaßt eine Kontrollgruppe von 500 gesunden jungen Männern als generelles Norm-Kollektiv, eine weitere befaßte sich mit 200 Patienten unter Vollnarkose, aber in ansonsten allgemein guter gesundheitlicher Verfassung (Grüning 1996; Werner 1996).
Eine dritte Studie bezieht sich auf Patienten, die unter chronischen Schmerzen des Stütz- und Bewegungsapparates leiden (Geier 1995), und eine vierte, gemeinsam mit Rosalie Rebollo Pratt und ihrer Forschungsgruppe von der Brigham Young University durchgeführt, vergleicht ver-schiedene Entspannungstechniken in Verbindung mit Musik, die zur Linderung der Schmerzen während der Geburt angewandt werden (Lex, Pratt, Abel u. Spintge, 1996).
Die bisher gewonnenen Ergebnisse scheinen unsere Hypothese zu erhärten, wonach die AAM es den Patienten ermöglicht, eine normale gesunde Variabilität vegetativer Parameter zu entwickeln. Das würde bedeuten, daß eine signifikante Wirkung musikalischer Stimuli auf Streßreaktionen im neurovegetativen Nervensystem gegeben ist - und zwar dergestalt, daß durch sie die gesteigerte sympathische Nervenaktivität (Streßreaktion) sowie die Schmerzempfindung abgeschwächt wird. Übereinstimmende Ergebnisse liegen auch von früheren Studien vor, in denen Streßhormonspiegel und kardiorespiratorische Parameter in vergleichbaren Situationen gemessen wurden (Spintge & Droh 1987, 1992a, 1992b).
Zusammenfassend kann zumindest gesagt werden, daß der wahrgenommene emotionale Inhalt von Musik jetzt einer wissenschaftlichen Analyse zugänglich gemacht worden ist. Es ist möglich geworden, die somatomotorischen, hormonalen, zentralnervösen und vegetativen Manifestationen und Intensitätsgrade verschiedener Emotionen qualitativ zu unterscheiden und einer quantitativen Messung zu unterziehen (s. auch Koepchen et al. 1993; Machleidt 1989, 1992; Petsche, Lindner, Rappelsberger u. Gruber 1989; Posner & Raichle 1994; Raichle 1994; Sergent 1993). Da die Musik das intensivste emotionale Kommunikationsmittel darstellt, ist mit Hilfe der erwähnten Forschungsergebnisse auch die emotionale Wirkung der Musik einer wissenschaftlichen Analyse zugänglich gemacht worden. Da darüber hinaus die neurovegetative Rhythmizität und das emotionale Verhalten aneinander gekoppelt sind, eröffnet eine Kombination all dieser Ansätze weitere vielversprechende Forschungsbereiche in der MusikMedizin.
Wo spielt die Musik?
An dieser Stelle werden einige Leser fragen "Wo ist hier eigentlich die Musik geblieben?" Die Antwort hierauf muß von denen unter Ihnen gegeben werden, die als Musiker, Tänzer, Musikologen, Musikpsychologen, Musiktherapeuten oder Ärzte tätig sind. Es ist mit Sicherheit nur die halbe Wahrheit, wenn man Musik als strukturierte (organisierte) Abfolge von komplexen, dynamischen, akustischen Reizimpulsen über die Zeit mit einer spezifischen Raum-Zeit-Repräsentation im Gehirn beschreiben würde. Zudem kann Kunst an sich nicht großartig quantifiziert werden, ohne sie dabei zu zerstören. Indessen mindert die Notwendigkeit eines eher qualitativ orientierten Zuganges zur Musik als therapeutischem Hilfsmittel keinesfalls die Reputation der Musiktherapie und MusikMedizin und ihre Anerkennung durch die medizinisch-wissenschaftliche Gemeinschaft (Spintge & Droh 1992c). Wenn wir Musik in der Medizin zum Einsatz bringen wollen, müssen wir das Gesamtbild betrachten - und um das zu können, müssen wir auch in Alice´s Zauberspiegel schauen.
Quellenverzeichnis
Abel, H.-H., Klüssendorf, D. u. Koepchen, H.P. (1989) A new approach to analyzing the neurovegetative state in man. In: R. Droh &
R. Spintge (Eds.), Innovatios in physiological anaesthesia and monitoring (S. 21 - 34), Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York.
Abel, H.-H., Berger, R., Conze, P., Droh, R., Klüssendorf, D., Koepchen, H.P., Koralewski, H.E., Krause, R. und Spintge, R. (1994). Kardiorespiratorische Funktionsidagnostik und Trainingssteuerung. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 45, S. 8 - 9.
Abel, H.-H., Geier, J., Pratt, R.R., Spintge, R. u. Droh, R. (1996). Effects of music listening on cardiovascular-respiratory parameters of chronic pain patients. In: Pratt & Spintge, S. 193- 205.
Aldridge, D. (1993). Artists or Psychotherapists ? The Arts in Psychotherapy 20, S. 199 - 200.
Bohm, D., Peat, F.D. (1987). Science, order and creativity. Wiley, New York.
Briggs, J., Peat, F.D. (1989). Turbulent mirror. An illustrated guide to chaos and the science of wholeness. Harper & Row, New York.
Cramer, F. (1989). Chaos und Ordnung. Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart.
Dodge, C. u. Bahn, C.R. (1986). Musical Fractals. Byte 6, S. 13.
Droh, R. (1996). Outlook. In: Pratt & Spintge, S. xiii - xv.
Gerok, W. (1989). Ordnung und Chaos in der belebten und unbelebten Natur. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart.
Grüning, T. (1996). Herz- und Atemfrequenzmuster in der perioperativen Phase. Med. Inaug. Diss, Ruhr-Universität Bochum.Haken, H. (1978). Synergetics: An Introduction. Nonequilibrium phase transitions in physics, chemistry and biology. Springer, New York.
Haken, H. (1983). Advanced Synergetics. Unstability Hierarchies of self-organizing systems and devices. Springer Verlag Berlin - New York.
Haken, H., Kelso, J.A.S. u. Bunz, H. (1985). A theoretical model of phase transitions in human hand movements. Biological Cybernetics 51, S. 347 - 356.
Haken, H. (1986). Erfolgsgeheimnisse der Natur - Synergetik, die Lehre vom Zusammenwirken. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart.
Haken, H. (1991). Synergetics of physiological rhythms. In: H.P. Koepchen & T. Huopaniemi (Eds.), Cardiorespiratory rhythmicity and motor coordination. Proceedings of the 21. international congress of physiological sciences Helsinki 1989 (S. 217 - 223). Springer Verlag Heidelberg - New York.
Haken, H., u. Koepchen, H.P. (1991). Rhythms in physiological Systems. Springer Verlag Heidelberg - New York.
Haken, H., u. Wunderlin, A. (1991). Die Selbststrukturierung der Materie. Vieweg Verlag Braunschweig.
Haken, H. (1992). Das Konzept der Synergetik und deren Anwendung in Biologie und Medizin. Medizinisch-systemtheoretisches
Gespräch. Lüdenscheidt, 28. Mai 1992.
Hofstadter, D.R. (1979). Goedel, Escher, Bach an Eternal Golden Braid. The Harvester Press, Hassocks (USA).
Holst, E. v. (1939). Die relative Koordination als Phänomen und als Methode zentralnervöser Funktionsanalyse. Ergebnisse der Physiologie 42, S. 228 - 306.
Kepler, J. (1594). Mysterium Cosmographicum. Graz (Österreich).
Koepchen, H.P., Droh, R., Spintge, R., Abel, H.-H., Klüssendorf, D. u. Koralewski, H.E. (1992). Rhythmicity and music in medicine.
In: R. Spintge & R. Droh (Eds.), MusicMedicine, S. 39 - 70. MBB Music, Saint Louis (USA).
Kümmel, W.F. (1977). Musik und Medizin - Ihre Wechselbeziehungen in Theorie und Praxis von 800 bis 1800.
Alber Verlag Freiburg.
Lex, J., Pratt, R.R., Abel, H.H. u. Spintge, R. (1996). The effects of music listening and biofeedback interventions on cardiac
chronotropic control of women in childbirth. In: R. R. Pratt & R. Spintge (Eds.), MusicMedicine, Vol. 2, S. 182 - 192. MBB Music, St. Louis (USA).
Machleidt, W., Gutjahr, L. u. Mugge, A. (1989). Grundgefühle - Phänomenologie, Psychodynamik, EEG-Spektralanalytik.
Monographien Gesamtgebiet Psychiatrie (Berlin) 57, S. 1 - 251.
Machleidt, W. (1992). Basic emotions reflected in EEG-coherence. International Journal of Psychophysiology 13 (3), S. 225 -232.
Mandelbrot, B.B. (1977). The fractal geometry of nature. Freeman, New York.
Mandelbrot, B.B. (1991). Die fraktale Geometrie der Natur. Birkhäuser Verlag Basel.
Maranto, C.D. (1992). A comprehensive definition of music therapy with an integrative model for music medicine. In: R. Spinge & R. Droh (Eds.), MusicMedicine, S. 19 - 29. MBB Music, Saint Louis (USA).
Petsche, H., Lindner, K., Rappelsberger, P. u. Gruber, G. (1989). Die Bedeutung des EEG für die Musikpsychologie. In: H. Petsche (Hrsg.), Musik - Gehirn - Spiel, S. 111 - 134. Birkhäuser Verlag Basel - Boston.
Posner, M.J. u. Raichle, M.E. (1994). Images of Mind. Freeman, New York.
Pratt, R.R. (1995). Professionalism in music therapy and MusicMedicine: issues of the past and future. In: R. R. Pratt & R. Spintge (Eds.), MusicMedicine, Vol. 2, S. 301 - 308. MBB Music, St. Louis (USA).
Prigogine, I. u. Stengers, I. (1986). Dialog mit der Natur (5. Aufl.). Pieper Verlag München.
Raichle, M.E. (1994). Bildliches Erfassen von kognitiven Prozessen. Spektrum der Wissenschaft 6, S. 58 - 63.
Schiek, M. (1994). Quantifizierung und Modellierung der respiratorischen Sinusarrhythmie. Bericht 2899, Forschungszentrum Jülich.
Sergent, J. (1993). Mapping the musician‘s brain. Human Brain Mapping I, S. 20 - 38.
Soffer, O. (1985). The upper paleolithic of the central Russian plain. Academic Press, Orlando (USA).
Spintge, R. u. Droh, R. (Hrsg.) (1987). Music in Medicine. Springer, New York - Heidelberg.
Spintge, R. (1989). Some Neuroendocrinological Effects of so-called Anxiolytic Music. International Journal of Neurology 19/20, S. 186 - 196.
Spintge, R. (1991). The Neurophysiology of Emotion and Its Therapeutic Application to MusicTherapy and MusicMedicine. In: Ch. Maranto (Ed.), Applications of Music in Medicine, S. 59 - 72. National Association for Music Therapy, Washington, D.C.
Spintge, R. (1991). Die therapeutisch-funktionalen Wirkungen von Musik aus medizinischer und neurophysiologischer Sicht - Musik als therapeutische Droge. In: Roesing, H. (Hrsg.), Musik als Droge?, S. 13 - 22. Villa Musica, Mainz.
Spintge, R. u. Droh, R. (1992a). MusikMedizin - Physiologische Grundlagen und praktische Anwendungen. Fischer Verlag Stuttgart.
Spintge, R. u. Droh, R. (1992b). MusicMedicine. MBB Music, St. Louis (USA).
Spintge, R. u. Droh, R. (1992c). Towards a research standard in MusicMedicine / music therapy: A proposal for a multimodal
approach. In: R. Spintge & R. Droh (Eds.), MusicMedicine, S. 345 - 349. MBB Music, St. Louis (USA).
Spintge, R. (1994). Musik in der klinischen Medizin. In: H. Brun, R. Oerter & H. Rösing (Hrsg.), Musikpsychologie - Ein Handbuch, S. 397 - 405. Rowohlt Verlag Hamburg.
Spintge, R. (1996). Music, Mathematics, Physiology and Medicine. In: R. R. Pratt & R. Spintge (Eds.), MusicMedicine, Vol. 2. MBB Music, St. Louis (USA).
Werner, R. (1996). Die Herzfrequenzvariabilität als Maß der chromotopen Herzkontrolle in einer Halotan-/ Lachgas-Narkose. Med. Inaug.-Diss., Ruhr-Universität Bochum.
Energon, das medizinisch-
psychologische Musikprogramm
Prof. Ralph Spintge gibt zusammen mit Prof. Hans-Helmut Decker-Voigt "Energon - das medizinsch-psychologische Musikprogramm" heraus: Selbsthilfeprogramme zu Themen wie Herz-Kreislauf, Verspannungsschmerz, Stressbewältigung, Tinnitus, Einschlafstörungen, Vitalisierung im Alter et al.
Wirkstoff: 100% Musik
Jedes Programm besteht aus zwei CDs mit Musik, Information und Übungen, sowie einem ausführlichen Handbuch. Eine kleine Reihe (eine CD mit Booklet) rundet das Programm ab. Energon ist bei Polymedia, Hamburg, erschienen, erhältlich bei www.silenzio.de und im Fachhandel und zählt zu den weltweit besten Produktionen auf diesem Gebiet!